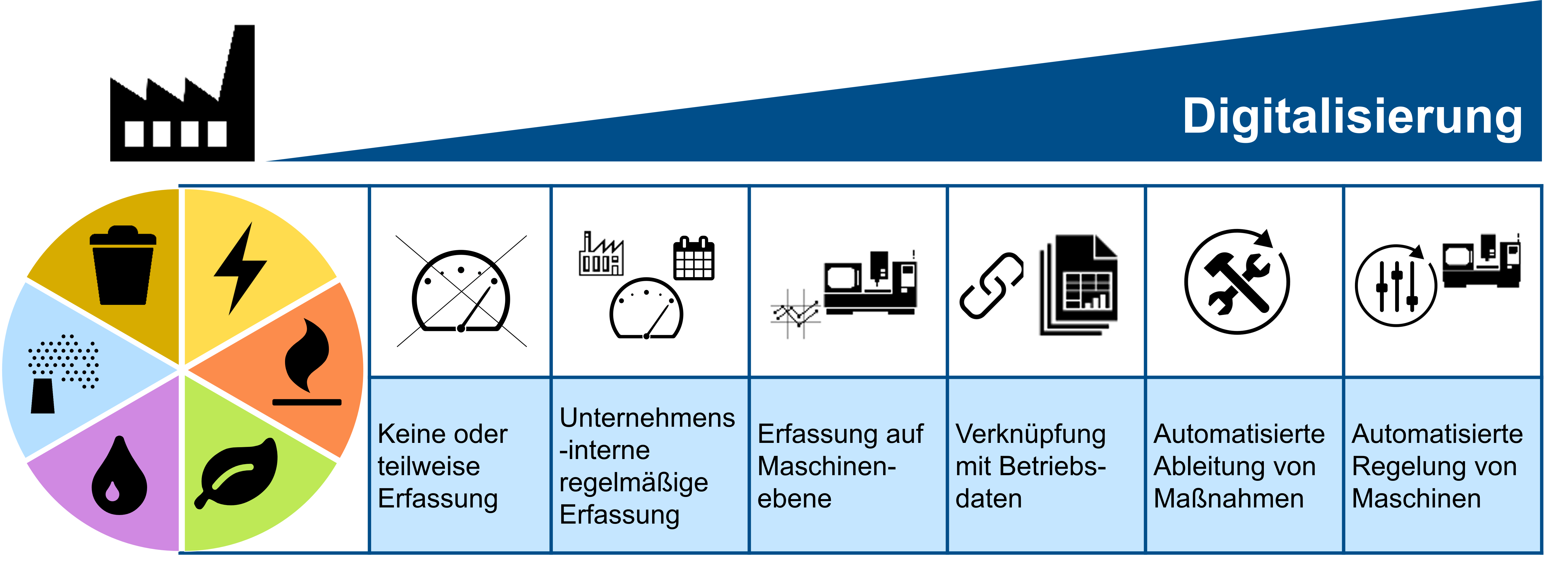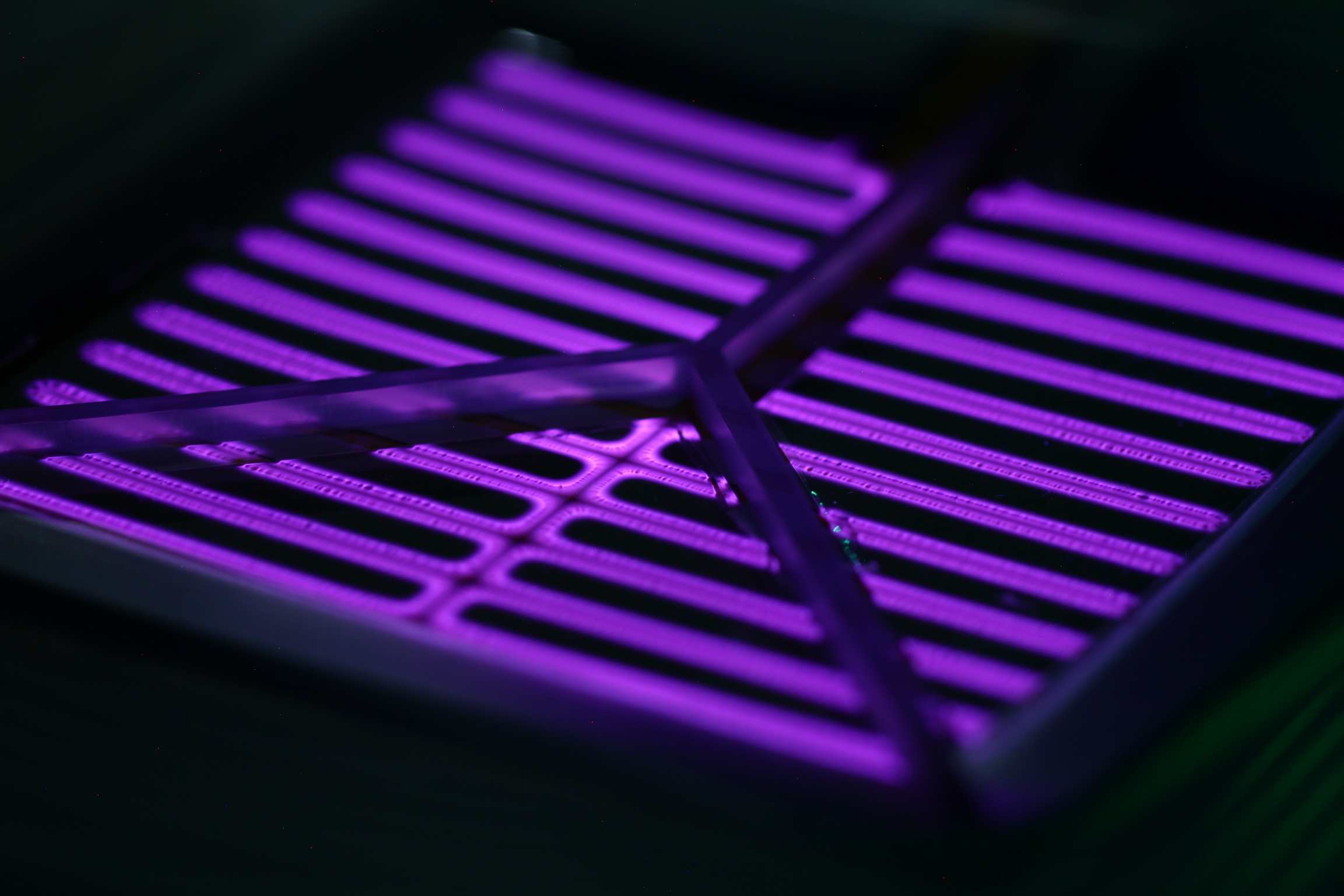Für 81 Prozent von Deutschlands Absolventen stehen Familie und Freunde an erster Stelle, Erfolg und Karriere folgen mit 54 Prozent auf Platz zwei. Das zeigt die Absolventenstudie 2017 des Kienbaum-Instituts.
Familie, Beziehung und Freunde sind die wichtigsten Werte im Leben von Absolventen der Generation Y. Das zeigt die Absolventenstudie 2017 des Kienbaum Instituts @ ISM für Leadership & Transformation. Demnach rücken 81 Prozent der 270 befragten Hochschulabsolventen Familie und Freunde an die erste Stelle, Erfolg und Karriere folgen auf Platz zwei mit 54 Prozent. Reich zu werden, halten hingegen nur neun Prozent der Absolventen für ein erstrebenswertes Ziel – und lediglich drei Prozent wollen das Leben richtig genießen und streben nach Zeit und Geld für Genuss und Konsum.
Handlungsfreiräume im Job nicht relevant
Bei der Arbeitgeberwahl legen laut Studie rund 60 Prozent jeweils Wert auf eine kollegiale Arbeitsatmosphäre, eine gute Work-Life-Balance und attraktive Karrieremöglichkeiten. „Deutschlands Absolventen scheinen wie geschaffen für das zu sein, was wir als New Work, also als selbstbestimmtes Arbeiten, bezeichnen“, sagt Walter Jochmann, Geschäftsführer des Kienbaum Instituts @ ISM. Gleichzeitig zeigt die Studie jedoch, dass in den Augen der Absolventen andere Faktoren, die ebenfalls typisch für New Work sind, nur eine geringe Relevanz haben: 18 Prozent wünschen sich einen Job in einem Unternehmen mit flachen Hierarchien, 16 Prozent wollen viel Handlungsspielraum haben und zwölf Prozent finden es wichtig, dass sie einen Chef haben, der gut führen kann.
„Es gibt zwei Seiten von New Work: einerseits ein hohes Maß an Flexibilität, attraktive Benefits und eine inspirierende Arbeitsumgebung, auf der anderen Seite flache Hierarchien, viel Freiraum und Chefs, die auf Augenhöhe führen und mehr Coach sind als der Boss, der nach dem Prinzip Befehl und Gehorsam arbeitet“, sagt Stefan Diestel, Akademischer Leiter des Kienbaum Instituts @ ISM und Psychologie-Professor an der International School of Management: „Die aktuelle Absolventengeneration scheint die Vorzüge von New Work mitnehmen zu wollen, ein Job mit viel Eigenverantwortung und Freiraum ist ihnen aber dann doch nicht ganz geheuer. Der Haken: Das eine funktioniert ohne das andere nicht.“
50 Prozent wollen nicht umziehen
Auch bei der Größe des Unternehmens setzen die Absolventen der Studie zufolge auf Bewährtes und auf Sicherheit. Nur sechs Prozent wollen ihre berufliche Laufbahn bei einem Start-up beginnen. Ein Drittel bevorzugt die Sicherheit eines Konzerns, und 22 Prozent möchten bei einem Mittelständler oder einem inhabergeführten Unternehmen arbeiten. Außerdem zeigt die Studie, dass die Mehrheit der deutschen Absolventen in der Nähe ihres aktuellen Wohnorts arbeiten will: 50 Prozent der Befragten wollen für ihren künftigen Arbeitsplatz nicht umziehen. (ph)